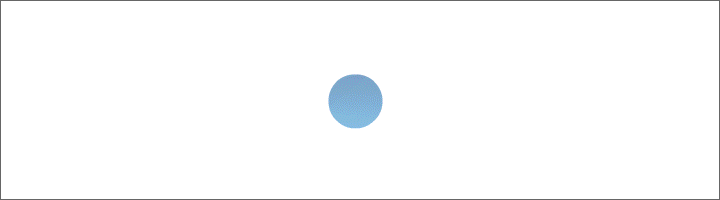

Über Deportation und Verbannung
Allgemeines zur Vorgeschichte der
Verschleppung von Rumäniendeutschen in die Sowjetunion
(Kleiner Tipp im Vorab:
Beim Anklicken aller unterstrichenen Bezeichnungen im Text
könnt Ihr Euch die Erklärungen dazu in Wikipedia angucken.
Durch einen Klick auf die Rückwärtstaste ←
kommt Ihr wieder zurück auf meine Homepage)
Seit dem Ersten Weltkrieg und auch während des Zweiten
Weltkrieges war Rumänien ein treuer Verbündeter Deutsch-
lands. Am 23. August 1944, als die sowjetischen Panzer die
rumänische Grenze im Osten des Landes überschritten und
die deutschen Resttruppen Richtung Berlin zurückdrängten,
beendete der rumänische König Michael I. (1927–1930 und
1940–1947) von Hohenzollern ganz abrupt und unerwartet sein
Waffenbündnis mit dem nationalsozialistischen Deutschland
und Rumänien schlug sich auf die Seite der Alliierten bis zur
endgültigen Kapitulation Deutschlands. Die Sowjets über-
rollten Rumänien, und als der Zweite Weltkrieg zu Ende war,
stand Rumänien allein da, gänzlich den sowjetischen Besatzern
ausgeliefert, die ihre Truppen in ganz Rumänien stationiert hatten.
Bereits im Februar 1945 beschlossen die Alliierten konkrete
"Reparationsleistungen“ Deutschlands an die Siegerstaaten
und speziell an die Sowjetunion (Abgabe von Maschinen
und von kompletten deutschen Industrieanlagen an die
Sowjetunion). Und dann auch deutsche Arbeitskräfte,
die an die UdSSR "geliefert", also deportiert werden
sollten, um das Land aufzubauen.
Das bedeutete ganz konkret auch für Rumänien die
sofortige Registrierung aller „Volksdeutschen“ zwecks
Deportation in die Arbeitslager der Sowjetunion. Dafür
vorgesehen waren Kriegsverbrecher und Deutsche, die
während des Krieges aktiv als Nazis agierten, zwecks
ihrer Bestrafung und Umerziehung zu "guten Bürgern".
Deportiert wurden jedoch meistens Männer und Frauen,
die keine direkte Verantwortung für den Krieg trugen.
Es reichte, wenn einer Deutscher war. Und das waren
die Eichenthaler im Banat allemal!
Für die sowjetischen Arbeitslager sollten alle damaligen
"volksdeutschen" Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren
und alle Frauen im Alter von 18 bis 33 Jahren verpflichtet
werden. Nur Frauen mit Säuglingen unter einem Jahr
waren von dieser Pflicht ausgenommen. Es gab aber auch
viele Ausnahmen von diesen "Regelungen", abhängig von
Region zu Region, manchmal sogar von Dorf zu Dorf...
Nach der Registrierung aller arbeitsfähigen Deutschen in
Rumänien, mussten sich die betroffenen Personen in den
Sammelstellen – das waren hauptsächlich Schulen - zum
Abtransport melden. Sollte eine registrierte Person nicht
„freiwillig“ im Sammelort erscheinen, nahm man eine
„Ersatzperson“ aus der Familie, egal wie jung oder alt
diese war, hauptsächlich arbeitsfähig.
WIKIPEDIA nennt folgende Zahlen, was "volksdeutsche"
Verschleppte in sowjetischen Arbeitslagern angeht:
130.000 Deutsche aus ganz Südosteuropa,
darunter 75.000 Menschen nur aus Rumänien;
aus dem Banat waren es 35.000.
Etwa 15 % der Russlanddeportierten aus Rumänien starben
während der Deportation. Weitere Menschen starben nach
der Rückkehr in die Heimat an den direkten Folgen der
Verbannung.
Viele Jahre später, in den 1990er Jahren, gab es Versuche
zur Rehabilitation all derjenigen Rumäniendeutschen, die
nach Russland zwangsverschleppt wurden. Die rumänische
wie auch die deutsche Regierung erkannten die Tatsache an,
dass die Russlanddeportation widerrechtlich und allein auf
Basis der Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit geschah.
So wurden zumindest die Deportation und die Zwangs-
arbeitsjahre per Dekret (118 / 1990) als Dienstjahre bei
der Berechnung der Rente angerechnet.
Und auf moralischer Ebene entschuldigte sich 1997 der
rumänische Außenminister Adrian Severin beim deutschen
Außenminister Klaus Kinkel nicht nur für das Unrecht, das
der deutschen Bevölkerung während der kommunistischen
Diktatur zugefügt worden war, sondern verurteilte u.a. auch
das Leid, das man den Rumäniendeutschen durch die
Verschleppung zur Zwangsarbeit in sowjetische Arbeits-
lager zugefügt hatte. Das war aber nur ein Tropfen auf den
heißen Stein zur Wiedergutmachung des unermesslichen
Leids einer ganzen Volksgruppe, die diskriminiert wurde,
einzig und allein dafür, dass sie Deutsche waren.
Noch vor dem eigentlichen Kriegsende im April 1945
durch die Kapitulation Deutschlands, also schon Anfang
Januar 1945, wurden 57 "volksdeutsche" Eichenthaler Frauen
ab dem 18. Lebensjahr und Männer ab dem 17. zu 5 Jahren
Zwangsarbeit in ein ukrainisches Lager der ehemaligen
Sowjetunion deportiert, um dort für den Wiederaufbau des
sowjetischen Siegerstaates für Reparationsleistungen in Kohlen-
gruben, Steinbrüchen, bei Eisenbahnlinien-, Straßen- und
Tunnelbauarbeiten, im kaukasischen Donbass-Gebiet, im Gulag
von Sibirien oder im äußersten eisigen Norden eingesetzt.
Das Kohlengrubenlager "Romanka", der Schacht Nr. 9, wo
meine Mutter untertags schuftete, liegt gemäß WIKIPEDIA
in der Region Krasnodar, im Donbassgebiet , wo sich das
Kriegsgefangenenlager Nr.148 für deutsche Kriegs-
gefangene des Zweiten Weltkriegs befand.
Im Nordkaukasus bestanden 12 Lagerverwaltungen mit
129 Einzellagern, darunter auch "Romanka".
Nr. Städte mit
Lager Lagerverwaltungen
147 Georgijewsk
148 Krasnodar
182 Schachty
228 Dsaudschikau
(Ordschonikidse)
237 Grosny
251 Rostow am Don
356 Taganrog
379 Machatschkala
421 Rostow am Don
424 Naltschik,
später Melitopol
430 Nowotscherkassk
475 Rostow am Don
Und hier sind die Namen aller Eichenthaler, die nach
Russland zwangsverschleppt waren. Ihre Namen
entnahm ich unserem "Eichenthaler Heimatbuch".
All diejenigen unter ihnen, die in den sowjetischen
Arbeitslagern ums Leben kamen, liste ich weiter unten
separat auf. Und das hier sind alle nach Russland
Verschleppten. Ganz zuletzt steht auch der Name
meiner Mutter, geborene Margarete Wosnek:
Zwangsverschleppt nach Russland:
Paul ADAM (geb. 1928)
Maria BOHMANN (geb. 1924)
Peter BOHMANN (geb. 1929)
Rosalia FISCHER (geb. 1927)
Maria FRITZ (geb. 1920)
Adam HALLABRIN (geb. 1928)
Anna JERHOFF (geb. 1922)
Barbara JERHOFF (geb. 1923)
Martin JERHOFF (geb. 1928)
Theresia JERHOFF (geb. 1926)
Theresia KÖSTNER (geb. 1918)
Maria KRAPFL (geb. 1924)
Nikolaus KRUSE (geb. 1926)
Rudolf KRUSE (geb. 1901)
Anna LIEGL (geb. 1921)
Georg LIEGL (geb. 1928)
Margarete LIEGL (geb. 1926)
Anton MEISNER (geb. 1907)
Katharina MILLICH (geb. 1922)
Anna PETRI (geb. 1917)
Anna PETRI (geb. 1923)
Anna PETRI (geb. 1926)
Anton PETRI (geb. 1903)
Anton PETRI (geb. 1928)
Magdalena PETRI (geb. 1924)
Margarete PETRI (geb. 1922)
Rosalia PETRI (geb. 1926)
Sepp PETRI (geb. 1905)
Anton PFAFFL (geb. 1927)
Lorenz PFEIFFER (geb. 1927)
Andreas RETTINGER (geb. 1926)
Franz RETTINGER (geb. 1904)
Theresia SCHESTAK (geb. 1915)
Eva SCHNEIDER (geb. 1925)
Franz SCHNEIDER (geb. 1928)
Lorenz SCHNEIDER (geb. 1927)
Margarete SCHWARZ (geb. 1926)
Josef STEMPER (geb. 1905)
Katharina STEYER (geb. 1927)
Sepp WELSCH (geb. 1903)
Hans WERSCHING (geb. 1914)
Paul WOLF (geb. 1927)
Luise WOSNEK (geb. 1922)
Margarete WOSNEK (geb. 04.10.1927) - meine Mutter
OPFER der Verschleppung:
Von den 57 in die Sowjetunion verschleppten Eichenthalern
starben 13, entweder während der sowjetischen Verbannung
unter menschenunwürdigsten Arbeits- und Lebensbedingungen
oder kurz nach ihrer Rückkehr, als direkte Folge dieser Verbannung.
Hier sind ihre Namen, entnommen auch aus dem gleichen Buch:
Anton BOHMANN (geb.1928 - 1946 verstorben in Russland)
Johann BOHMANN (1902 - 1945 verstorben in Russland)
Nikolaus BUSCHBACH (1926 - 1947 tödlich verunglückt in Russland)
Friedrich HALLABRIN (1906 - 1945 verstorben in Russland)
Michael HALLABRIN (1901 - 1945 verstorben in Russland)
Katharina KÖSTNER (1915 - 1948 verstorben in Russland)
Martion KÖSTNER (1906 - 1947 verstorben in Eichenthal)
Josef LUKAS (1903 - 1945 verstorben in Russland)
Barbara PESCHKA (1912 - 1946 verstorben in Russland)
Anton PFAFFL (1903 - 1945 verstorben in Russland)
Peter TRAUM (1920 - 1946 verstorben in Eichenthal)
Jakob WELSCH (1900 - 1946 verstorben in Russland)
Elisabeth WISCHAR (1920 - 1946 verstorben in Russland)

Ruhet alle in Frieden!

Eines der Opfer der Deportation war auch unser Eichenthaler
Landsmann, Johann BOHMANN, geboren 1902 in Wolfsberg.
Er wurde genau so wie weitere 56 Eichenthaler nach Russland
verschleppt, wo er ab dem 19. Januar 1945 für mindestens 5 Jahre
zum Wiederaufbau der UDSSR verpflichtet war. Er verstarb schon
am 29. Juli 1945, kaum ein halbes Jahr nach seiner Deportation.
Seine Enkelin Eva stellte mir diese Urkunden ihres Großvaters
zwecks Veröffentlichung in dieser Homepage zur Verfügung,
wofür ich ihr sehr dankbar bin.
Dies ist die Sterbeurkunde aus der ehemaligen Sowjetunion:

Und das ist die deutsche Übersetzung dazu, die wohlweislich
den genauen Ort des Todeseintritts nicht preisgibt:

Und hier ist nochmals die Bescheinigung, dass Johann Bohmann
nach Russland deportiert war. Ein Tag nach seinem Arbeitseinsatz
vom 28. Juli 1945, verstarb er leider viel zu früh, am 29. Juli 1945.
Wir alle trauern sehr um unseren Eichenthaler Landsmann, der in
jener schweren Nachkriegszeit, Frau und Kinder im Heimatdorf
zurück ließ:

Alle diese menschlichen Opfer waren für ein kleines Banater
Schwabendorf wie Eichenthal mit seinen ca. 400 Bewohnern
ein erheblicher Verlust, besonders in jener Nachkriegszeit, in
der alle Kräfte für die eigene Familie hätten eingesetzt werden
müssen, um die großen seelischen, aber auch wirtschaftlichen
und finanziellen Verluste, die der Krieg mit sich brachte,
zu überwinden: Kriegsgefangenschaft und Inhaftierungen,
Flucht und Vertreibung, Zwangsabgaben und Enteignungen.
Meine Mutter erzählte mir neulich zum ersten Mal, nach
vielen Jahren des Schweigens, ganz viele Einzelheiten über
jene schwere Zeit in sowjetischer Haft, von Anfang an bis zu
ihrer Entlassung aus dem sowjetischen Gulag "Romanka",
einem Kohlenrevier im ukrainischen Donezbecken.
In unserer Kindheit und Jugend machte sie manchmal nur
Andeutungen darüber, wie: "ihr habt es heute gut",
"ihr wisst ja nicht, was richtiges Arbeiten heißt",
"seid froh, dass ihr nie richtig Hunger gelitten habt",
"seid dankbar, dass ihr was Vernünftiges auf dem Teller habt",
"werft kein Brot und Essen unüberlegt weg,
andere hätten damit lange leben können",
"lasst nie wieder Krieg zu" ...
Über jene Jahre, die sie in Russland als Zwangsverschleppte
verbrachte, werde ich Euch im nachfolgenden Kapitel
"Deportation 2" erzählen, denn ich bin mir ganz sicher, dass
sich so mancher in dieser wahren Geschichte wiedererkennt.
Es weilen bestimmt nicht mehr viele unserer Eltern oder
Großeltern unter uns, die jene harten und entbehrungsreichen
Zeiten miterlebt haben, doch es ist vielleicht ganz gut,
wenn wir die Erinnerung daran wach halten.
In der Stadt Reschitz (Reșița), im Banater Bergland, da wo
meine Eltern lebten, wo mein Vater 1993 gestorben und auch
beerdigt ist, gibt es seit einigen Jahren ein Denkmal zu
Ehren aller Russlanddeportierten. Da sind die Namen aller
Arbeitslager eingraviert, wohin Banater Berglanddeutsche
zur Zwangsarbeit verschleppt worden sind. Auch der Name
Romanka
steht dort drauf. Jährlich finden dort feierliche Gedenk-
stunden statt, um die Erinnerung an das Leid so vieler
Unschuldigen zu erinnern. Und so sieht das Denkmal aus:


Macht's gut! Und vergesst nicht!
Das wünscht Euch allen,
Annala,
heute, am 21. Juli 2013